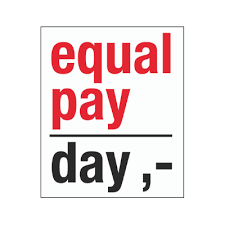Wir leben in Zeiten, wo nichts mehr sicher scheint. Wir müssen uns mit plötzlich auftretenden Krisen
und weltumgreifenden Problemen auseinandersetzen. In solchen Zeiten müssen wir umdenken.
Manche scheinen auf Kultur als Erstes verzichten zu wollen.
Dass uns Kultur im Umgang mit Problemen aber hilft und gerade ihr Fehlen rückwirkend Krisen
vertieft, merken wir erst später.
Das Schützen und Fördern von Kultur ist deshalb am Vorabend neuer, großer Herausforderungen so wichtig wie nie.
Nicht allein deshalb fördern wir Kunst und Kultur der Vergangenheit und Gegenwart. Wir fördern
Kunst in ihrer Vielfalt und Komplexität. Wir fördern das Experiment und den Gang ins Risiko. Wir
fördern Kultur als Motor für Standorte, Regionen und ein künstlerisches Forschen.
Internationaler Austausch und Spitzen-Kultur sind dabei ebenso wichtig wie der Austausch der
Regionen und die Kooperation von Stadt und Land. Sie befruchten sich gegenseitig.
Bayerns Kunst und Kultur sind reich, vielfältig und kraftvoll. Sie sind der Spiegel unserer
Gesellschaft. Diesen Schatz gilt es zu bewahren und in die Zukunft zu tragen. Und zwar so, dass alle
Menschen, die in Bayern leben, daran teilhaben können.
Der Zugang zu Kunst und Kultur ist ein universelles Menschenrecht. Alle Menschen sollen sowohl
teilhaben an den vielfältigen Ergebnissen künstlerischen Schaffens als auch selbst die Chance
haben, ihr kreatives Potential zu entfalten. Nur so kann Kunst inmitten unserer Gesellschaft
Diskursraum und Experimentierfeld unserer Demokratie sein.
Ein zentraler Baustein unserer Kulturprogramme ist deshalb die Vermittlung.
Den Zugang zu den Schätzen unseres reichen bayerischen Sammlungserbes und Brauchtums wollen
wir für alle Menschen in Bayern ausbauen. Das bedeutet, das Wissen um unsere Sammlungen zu
verbreiten, die Wertschätzung und das Verständnis für ihre Relevanz zu vertiefen und bei allem
Barrierefreiheit zu garantieren.
Bei allen Prozessen staatlicher Initiativen und Institutionen, bei allen Zielen, Entscheidungen und
Maßnahmen muss eines selbstverständlich sein: Transparenz.
Kunst ist frei. Kunst dient niemandem. Sie lässt sich nicht auf ihren materiellen Wert reduzieren. Kunst ist
vielfältig, deutungsoffen und nie homogen, sie ist dynamisch, hybrid und niemals statisch. […] Wir
schützen die Freiheit der Künste und wenden uns dagegen, Kultur und die Künste vereinheitlichen zu
wollen oder alleinige Deutungshoheit über sie zu beanspruchen.“
Grundsatzprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
BOTTOM UP – DIALOG KOMMT ZUERST
Ein zentraler Schatz von Kunst und Kultur ist der Diskursraum, den sie eröffnen. Entsprechend soll
Dialog die Basis von Kulturpolitik sein.
Dabei reicht es nicht, Verbändeanhörungen abzuhalten, in engem Kontakt zur Kulturszene des
Landes zu stehen, fleißig Kulturorte zu besuchen und Landtags-Anhörungen auszuwerten.
Es braucht Strukturen, die regelmäßig Kreative wie Publikum einbeziehen und diese auf Augenhöhe
miteinander in Dialog treten lassen. Mit den Ergebnissen können dann Leitplanken für
kulturpolitische Entwicklungen gesetzt werden und Handlungsfelder für Kulturpolitik in einer sich
wandelnden Welt immer wieder neu erkannt und nachgeschärft werden. Bottum up: Entscheidungen,
Ideen, Lösungen kommen von unten, von individuellen Beteiligten und werden nicht von
Entscheidungsbefugten aufgepfropft.
Dabei müssen Kommunen, Regionen, Kulturschaffende, Verbände und Zivilgesellschaft in diesen
dialogischen Formaten als Querschnitt aller Menschen unseres Landes zum Beispiel auch
Jugendliche, Studierende und Menschen mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen
einbeziehen.
Dialogforen können regionalisiert stattfinden oder Regionen vernetzen. Sie können Kooperationen
verbessern, Potentiale entdecken und helfen, neue Standards für die Kulturpolitik festzulegen.
Dokumentation und Auswertung der dialogischen Arbeit ist die Basis, um kulturpolitische
Handlungsfelder immer wieder neu zu definieren.
Unser Anspruch:
- Dialogprozesse zwischen Politik, Entscheidungsbefugten, Kreativen und Publikum starten
- gemeinsam Leitplanken für kulturpolitische Entwicklungen setzen
- dauerhafte Strukturen für dialogische kulturpolitische Formate schaffen
FREIE KUNST UND KULTUR BRAUCHT VERLÄSSLICHE STRUKTUREN
Das Grundsatzprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert: „Kultur und die Künste brauchen
öffentliche Förderung auf Grundlage transparenter Kriterien“ in einem Umfeld, das Kultur als Rohstoff
von Demokratie respektiert und ermöglicht.
Für Bayern bedeutet das, klare Ziele staatlicher Kulturpolitik zu formulieren.
Unser Kulturbegriff ist dabei offen und breit. Er umfasst Musik, Theater, Tanz, Museen, Bildende
Kunst, Literatur, Soziokultur, Jugendkultur, Film und Medien, Performance und Sound, Archivwesen,
Laienmusik und Amateurtheater, Festivals, Nachtkultur und Kinos, Brauchtum und die Tradition
unserer Feste und Märkte; alle künstlerischen Sparten und alle Typen von Kultur, von Institutionen,
Initiativen, Vereinen und Bräuchen in ganz Bayern – ob frisch angekommen oder schon lange hier
beheimatet.
Um die Freiheit der Kunst zu bewahren, braucht es für „Kulturschaffende eine verlässliche und
angemessene soziale Absicherung“ (Grundsatzprogramm).
Mindestgage muss selbstverständliche Minimalanforderung bei freier Tätigkeit sein, genau wie
tarifvertragliche Bezahlung bei Festanstellung.
Öffentliche Finanzierung darf keine prekären Verhältnisse fördern! Das betrifft freiberufliche
Leistungen in allen Kulturbereichen, auch in Sparten, die bisher keine Honorare vorsehen, wie z.B.
Ausstellungen. Bei staatlichen Aufträgen nehmen wir deshalb die Honorierung der beteiligten
Kreativen besonders in den Blick.
Die Gestaltung der Verträge muss sich hierbei orientieren an sozialer Nachhaltigkeit, insbesondere
Geschlechtergerechtigkeit und Familienfreundlichkeit. Auch die Höhe und Bedingungen von
Stipendien und Preisen, die zum Beispiel oft nicht kompatibel sind mit der Lebenswirklichkeit von
Eltern, überprüfen wir.
Für Daueraufgaben wie Bildungs- und Beratungsangebote an staatlichen und nichtstaatlichen
Museen richten wir Dauerstellen ein. In der freien Kulturarbeit geht unser Ziel weg von Dauer-
Projektisierung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, Festigung und Verstetigung von Strukturen.
Dazu gehört auch, den Staatshaushalt im Vorjahr des jeweiligen Haushaltsjahres zu verabschieden,
damit Gelder rechtzeitig zur Verfügung stehen, wenn sie ausgegeben werden müssen.
Unser Anspruch:
● angemessene soziale Absicherung für Kunst- und Kulturschaffende durch
Mindesthonorare in allen Sparten, insbesondere für Solo-Selbstständige, durch faire
Verträge auf Augenhöhe und durch Nachwuchsprogramme überall, wo staatliche
Mittel fließen
● Verankerung von Grundsätzen sozialer Nachhaltigkeit in staatlichen
Förderrichtlinien, insbesondere Geschlechtergerechtigkeit und
Familienfreundlichkeit
● Weg von der Dauer-Projektisierung hin zur nachhaltigen Entwicklung und
Verstetigung von Strukturen
VERNETZUNG UND VERBESSERUNG VON STRUKTUREN
Unsere Welt ist schnelllebig. Auch unsere Kultur ist dem ausgesetzt: Knappe Planungshorizonte,
Unsicherheit und ständige Veränderung gehören zum Alltag.
Diese Veränderungen wirken auch auf staatliche Institutionen, auf ihren Aufbau, ihre Verwaltung,
ihre Organisation. Allerdings sind hier die Strukturen oft träge und können nicht angemessen auf
diese Veränderungen reagieren. Deshalb braucht es Transformations-Prozesse auf allen Ebenen.
Damit diese gelingen und unsere Institutionen fit für die Zukunft machen, wollen wir beim
Entwickeln solider Strukturen unterstützen.
Intern können Methoden und Strukturen immer wieder überdacht werden: Hilft es vielleicht, weg
von starren Hierarchien zu kommen und mehr Agilität zu gewinnen? Warum nicht alle die
miteinbeziehen und binden, von denen Kulturorte leben: das Publikum, das angestellte Team, die
Nachbarschaft, die Mitglieder, Aktiven oder den Freundeskreis. Sind Formate oder Strukturen
denkbar, an denen sie konkret beteiligt sind?
Aber der Blick muss auch nach außen gerichtet werden: Lassen sich Prozesse anstoßen, von denen
Gesellschaft und Institution wechselseitig profitieren? Wo zum Beispiel können sich Institutionen als
öffentlicher Raum etablieren, welche Kooperationsformen mit Schulen, Vierteln, Betrieben, etc. sind
möglich? Wen erreicht man noch nicht, und wie könnte man diese Personen noch erreichen?
Ziel ist ein Wachsen und Bestehen in dieser sich rasch wandelnden Zeit.
Wir schaffen hierfür beratende Formate für die Organisationsentwicklung, die für alle Bereiche
unseres Kulturlebens zugänglich sind.
Grundsätzlich wollen wir Bewährtes sichern und Neues ermöglichen. Eine weitere Baustelle sind hier
die Fördermodelle, die diese zentrale Aufgabe von Kulturpolitik vielfach nicht erfüllen. Häufig sind
Mittel gebunden oder werden nur für kurzfristige Projekte zur Verfügung gestellt.
Deshalb wollen wir zusätzliche Fördermöglichkeiten schaffen, die nachhaltig und verlässlich wirken.
Sie sollen mehrjährig den Aufbau neuer, besonders innovativer oder interessanter Initiativen
unterstützen und ihre Weiterentwicklung ermöglichen.
Organisationsentwicklung und die Verbesserung von Strukturen betreffen auch die staatliche
Verwaltung. Für nachgeordnete wie übergeordnete Verwaltung gilt: Jede Einheit kann sich durch
Reflektion, Analyse, Benennung von Handlungsfeldern, Zuständigkeiten und Zielen verbessern,
Doppelstrukturen vermeiden und die mannigfaltige Expertise bündeln.
Eine Verschlankung von Abläufen wird viel bewirken. Ein weiterer Punkt ist eine bessere Verzahnung
von Zuständigkeiten und Anlaufstellen.
In all den Jahrzehnten der Dominanz in Bund, Land, Bezirken und Kommunen gelang es
insbesondere der CSU nicht, die gutsherrenartige Mittelvergabe zu einer serviceorientierten
Kulturpolitik umzugestalten:
Zuständigkeiten sind zersplittert. Die Suche nach Unterstützung für Kulturschaffende ist oft eine
Tortur. Antragstellung ist selten digital möglich. Abrechnungen sind nicht standardisiert und viel zu
kompliziert.
Ein Beispiel sind hier die Initiativen der kulturellen Bildung, die für unsere Kinder und die Zukunft
unserer Gesellschaft so wichtig sind. Sie sind verwaltungsseitig schlecht vernetzt. Eine zentrale
Anlaufstelle gibt es nicht.
Es gilt aber auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft, die sowohl im Fokus der Kultur- als auch der
Wirtschaftspolitik steht. Um im gewollten Maße zu wachsen, braucht sie eine sinnvolle Verzahnung
der Ressorts und Verwaltungsebenen.
Dabei ist es die Aufgabe der Politik, die Menschen, die ihre Expertise und Erfahrung in den Dienst
des Staates gestellt haben, bei der Weiterentwicklung unserer Staatsverwaltung zu einer agilen
Organisation zu unterstützen.
Unser Anspruch:
- Beratungsangebote für Transformationsprozesse unserer Kulturinstitutionen
- Verzahnung und Bündelung von Kompetenzen der Verwaltung für den kulturellen Bereich
- Abbau von Bürokratie, einheitliche Standards zur Abwicklung und Abrechnung von Förderungen
- Förderung von mehrjährigem Strukturaufbau für Kulturprojekte und Kulturinitiativen
RAUM FÜR KULTUR
Kulturorte gehören zu den Dritten Orten, die wir als Gesellschaft neben dem Zuhause (Erster Ort)
und dem Arbeitsplatz (Zweiter Ort) brauchen, weil sie uns Räume der Begegnung und Gemeinschaft
bieten und so unser Leben bereichern.
Waldbühne, Festival-Wiese, Kino, Wirtshaus-Nebenraum, Theater, Museum, Comic-Laden,
leerstehender Supermarkt, Bibliothek, Dorfplatz, Staatstheater, Club, Scheune, Bibliothek, Bus und
viele andere mehr: Lebendige Orte für Kultur schaffen Identität und Zusammenhalt. Auch gut
etablierte Kulturorte sind dabei oft gefährdet. Es ist Aufgabe von Kulturpolitik, sie zu sichern und zu
vernetzen.
Mehr Raum und besseren Raum für Kunst und Kultur schaffen und erhalten bedeutet: in die Zukunft
blicken, bauen, sanieren, neu und anders nutzen. Wo Räume knapp sind, soll zeitgemäße
Mehrfachnutzung gefördert werden. Laufende Bauvorhaben müssen genauso vorangetrieben werden
wie die beschlossenen und notwendigen Sanierungs- und Neubauvorhaben für Bayern, die noch
immer auf einen Startschuss warten.
Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, die Räume zeitgemäß anzupassen.
Dazu gehören die Förderung der Barrierefreiheit, energetische Sanierung, Generalsanierung und die
bedarfsgerechte Erweiterung von Liegenschaften in Staatsbesitz. In Zukunft werden die Räume für
Kultur anders aussehen, sie werden offener sein und von verschiedenen Gruppen auf
unterschiedliche Weise genutzt. Die Pläne für eine künftige Nutzung müssen Teil der Sanierung sein.
Gerade kommunale und ehrenamtliche Raum-Initiativen müssen hier unterstützt werden.
Raum für Kultur braucht örtliche Ansprechpersonen im ganzen Land, die Kultur ermöglichen und
vernetzen, die Ressourcen für öffentlichen und privaten Raum drinnen wie draußen kennen. Wir
nennen sie Regionalmanagement: Ansprechpersonen, die lokal und regional nach innen und außen
wirken, Kulturschaffende kennen, Räume vor Ort, Ehrenamtliche, den Kulturkalender vor Ort und
mehr. Aktuell ist es oft leichter, mit Kreativen im Ausland zu kooperieren, als die Oberpfalz und
Schwaben oder zwei Nachbar-Landkreise für ein gemeinsames Kulturprojekt zusammenzubringen.
Das wollen wir ändern.
„Kulturorte sind für die Gesellschaft unverzichtbar“
(Grundsatzprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Unser Anspruch:
- bestehende Kulturorte schützen
- bedarfsgerechte Räume für Kulturschaffen
- sinnvolle Mehrfachnutzungs-Konzepte staatlicher Räume
- Sanierungsstau bayerischer Kulturinstitutionen abbauen
- Regionalmanagement in ganz Bayern etablieren
STADT LAND CHANCE
Bayern hat in ländlichen Räumen ein gewachsenes, vielfältiges und starkes Kunst- und Kulturleben,
das häufig von engagierten Ehrenamtlichen getragen wird. Diese haben natürlich wenig Ressourcen
zur Verfügung, um steigende Mieten oder personelle Engpässe aufzufangen.
Dabei leisten Kulturorte hier viel: Sie geben Impulse für ganze Regionen. Das passiert natürlich auch
durch die Wiederbelebung leerstehender Gebäude und Ortsmitten. Eine alte Brennerei, die Bühne
wird, ein wenig genutztes Lager, das sich Lesungen öffnet, ein leerstehender Firmensitz, der
Ausstellungen beheimatet, ein von Schließung bedrohtes Kino, das sich zum Begegnungszentrum
weiterentwickelt.
Kulturorte, die aktiv sind und sich an Besonderheiten und Bedürfnissen der Gemeinschaften vor Ort
orientieren, schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch eine staatliche Institution kann die
Gesellschaft einladen und offen sein für Kooperationen und vielfältige Nutzungen. Soziale und
kulturelle Aspekte befruchten sich gegenseitig im Zusammenspiel von Bildung und Genuss.
Kulturarbeit ist hier immer auch Soziokultur-Arbeit. Vielerorts ist der Zugang zu Kultur- und
Begegnungsorten bisher nur durch die Fahrt in das nächstgelegene Zentrum möglich. Gerade hier kann
eine soziokulturelle Nutzung von Räumen, die bislang gar nicht, kaum oder nur für einen
Zweck genutzt werden, integrative Kräfte mobilisieren und Identität stiften.
Was gewinnen wir, wenn wir neue Orte für Kultur erschließen oder bestehende breiter aufstellen?
Wir gewinnen neue Perspektiven, schaffen niederschwellige Zugänge, beziehen neue Zielgruppen
mit ein und inspirieren zu frischen Partnerschaften.
Soziokultur-Arbeit braucht hier lokale, regionale und spartenübergreifende Netzwerke, die
professionell organisiert sind, aber nach individuellem Bedarf vor Ort genutzt werden können.
Denkbar ist vieles – von Angeboten in den Ferien, Jugendkultur bis hin zu generationsübergreifenden
Projekten oder Angeboten für Menschen in hohem Alter.
Bei der Entwicklung spezieller Förderinstrumente für solche Dritten Orte kann der Freistaat in
Partnerschaft mit Landkreisen, Städten und Gemeinden von den Erfahrungen anderer Länder sowie
der Kulturstiftung des Bundes profitieren.
Unabdingbar ist dabei die Unterstützung finanzschwacher Kommunen durch die Begrenzung des
Eigenanteils. Das Programm “Aller.Land”, das die Bundesregierung im Frühjahr 2023 auf den Weg
gebracht hat, nimmt die Kulturförderung ländlich geprägter Räume in den Fokus. Hier werden
Regionen und kleine Kommunen gezielt dabei unterstützt, beteiligungsorientierte Kulturprogramme
zu entwickeln und umzusetzen. Ähnlich kann auch auf Landesebene Kulturförderung in ländlich
geprägten Regionen und kleinen Kommunen gelingen und Kulturinstitutionen vor Ort für neue
Aufgaben, Inhalte und Kooperationen öffnen. Auch hochwertige Gastspiele tragen zu einer Stärkung
der kulturellen Infrastruktur im ländlichen Raum bei. Diese wollen wir finanziell und strukturell
fördern.
Ländliche Räume und urbane Zentren brauchen passgenaue Kulturförderung. Dazu gehört
insbesondere in kleineren Kommunen auch das Bewahren einer lebendigen Nachtkultur mit ihren
Musikbühnen, Festivals, Clubs und Kinos.
Wir schaffen leicht zugängliche Beratungen zur Monetarisierung digitaler Angebote. Wir fördern
transparent technologische und nicht-technologische Innovationen. (Warum sollen nur
rückenverstellbare Kinosessel gefördert werden, nicht aber ein innovatives Kino-Seniorenprogramm
am Morgen? Andere Länder tun dies, Bayern nicht.) Die Nachtkultur unterstützen wir dabei, Barrieren
abzubauen, außerdem kümmern wir uns darum, dass diese Orte auch mit dem ÖPNV gut zu
erreichen sind. Und wir unterstützen dort, wo es zum Beispiel Nutzungs- oder andere Konflikte gibt,
durch ein allparteiliches Konfliktmanagement (AKIM).
Metropolen weltweit speisen ihre Attraktivität nicht zuletzt aus Spitzenkultur, Weltklasse
künstlerischer Leistungen, aus denen unser kulturelles Erbe hervorgehen wird und die auf Top-
Niveau zeitgenössische wie tradierte Kunst praktizieren und so auch Innovation anstoßen können.
Von Spitzenkultur mit internationaler Strahlkraft profitiert unser gesamtes Land auf
unterschiedlichen Ebenen: Arbeit für freie Kreative, Tourismus, Motor für die Wirtschaftsleistung
einer Region mit Arbeitsplätzen, Ausbildungsangebot und Kaufkraft, aber auch Ansehen, Image und
Identität.
Neben der Spitzenkultur, die in Zukunft noch tiefer in die Gesamtgesellschaft als Angebot für alle
hineinwirken sollte, darf aber das gesamte Kulturangebot in den größeren urbanen Zentren des
Freistaats in seiner Differenziertheit, Vielfalt und eigenen Innovationskraft nicht aus dem Blick
geraten.
Insbesondere die Freie Szene leistet hier seit Jahren unter oft großen persönlichen Entbehrungen
Enormes; kulturelle Bildung und soziokulturelle Arbeit finden auf hohem Niveau statt – trotz lange
fehlendem und inzwischen hart erkämpftem, schmalem Zugang zu Landesmitteln für die Freie Szene
in den beiden größten Kommunen im Land, trotz fehlender Landesförderung für Soziokultur, wie andere
Bundesländer sie leisten.
Unser Anspruch:
- Antrags- und Abrechnungsstrukturen von Freistaat und kommunalen Ebenen harmonisieren
- lokale und lebendige Nachtkultur bewahren und die Zugänglichkeit durch besseren ÖPNV
und Abbau von Barrieren verbessern
- stetig gewachsene Vielfalt regionaler Kulturangebote parallel zu bayerischer Spitzenkultur
von Weltrang fördern
- regionale Ansprechpersonen für Kulturschaffende, die vernetzen und koordinieren helfen
- Landesförderung von Soziokultur wie in anderen Bundesländern
KULTURFONDS
“Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.“
Verfassung des Freistaats Bayern, Art. 3
Gut 8 Millionen Euro aus Mitteln des Kulturfonds wurden 2023 in Bayern verteilt. Bei einem
Haushaltsvolumen von 71 Milliarden Euro sind das gerade einmal 0,0112%. 2023 floss über die Hälfte der
Kulturfonds-Mittel in Bauprojekte. Mangelnde Transparenz und fehlende Jury-Verfahren
verstärken den Anschein von Kulturförderung nach Gutsherren-Art und Stimmkreis-Wahlgeschenken.
Soll der Kulturfonds allerdings allen Kulturschaffenden und Menschen in Bayern dienen, bedarf es einer
grundlegenden Reform:
Es braucht zunächst eine transparente Vergabe nach nachvollziehbaren Kriterien durch Fachjurys.
Digitale Antragsverfahren wären absolut zeitgemäß und würden endlich mehr Klarheit und Fairness
schaffen.
Eine Aufstockung des Kulturfonds ist ohnehin an der Zeit.
Einhergehend sollte er geöffnet werden für München und Nürnberg als Landeshauptstadt und
Frankenmetropole. Von deren besonders hoher Dichte an Kunstschaffenden könnte das ganze Land
profitieren – eine Synergie, wie sie die bisherigen Richtlinien des Kulturfonds nicht geschaffen
haben. Wir wollen dabei die Fördersummen analog zur Einwohnerzahl deckeln. Die Öffnung des
Kulturfonds für Kreative aus München und Nürnberg ist auch ein entscheidender Hebel beim Zugang
zur sogenannten Stadt-Land-Bund-Förderung, bei der sich Bund, Land und Kommunen jeweils
anteilig beteiligen, wenn alle drei Ebenen fördern.
Auch Künstlerhonorare und Handlungskosten sollten förderfähig sein.
Es braucht eine konsequente Öffnung für Spartenübergreifendes außerhalb der in den Richtlinien
des Kulturfonds genannten Formate. Kunst entwickelt sich in ihren Ausdrucksformen ständig weiter,
allein schon durch den Fortschritt der Technik. Neue Formate werden bislang aber nicht
berücksichtigt.
Grundsätzlich muss eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Höhe der Mittel stattfinden,
um dieses wichtige Instrument über die Jahre zu bewahren.
Unser Anspruch:
- bayerischen Kulturfonds mit digitalem Antragsverfahren, transparenten und
nachvollziehbaren Vergabekriterien und Fachjurys reformieren
- Kulturfonds für die Metropolregionen Nürnberg und München gedeckelt öffnen
- Erhöhung und regelmäßige Anpassung der Mittel des Kulturfonds
- Öffnung des Fonds für alle Sparten und neue Form
FINANZIERUNG
Politik ist Priorisierung. Der Kultursektor krankt an struktureller Unterfinanzierung, es gibt bisher in
Bayern allerdings kaum politische Überlegungen und Leitlinien dazu, was staatliche Kulturpolitik
leisten soll und wie sich die Finanzierung dieser Aufgaben im Staatshaushalt widerspiegeln müsste.
Wenn ein Markus Söder von einer „bayerischen Documenta“ oder einer „bayerischen Berlinale“
fabulierte, folgte den Ankündigungen nie ein Handeln. Kulturpolitik muss aber mehr leisten, als alle
fünf Jahre eine neue Intendanz zu wählen und in Wahljahren die Mittel zu erhöhen.
Kulturpolitik nach Gutsherrenart ist nicht mehr zeitgemäß.
Freistaat und Kommunen teilen sich vielfach die Verantwortung für öffentliche Kulturförderung.
Während die Kommunen die lokale Kulturförderung tragen, konzentriert sich der Freistaat auf
überregional und in ganz Bayern wirkende Einrichtungen und Aktivitäten. Staat und Kommunen
ergänzen sich und handeln vielfach gemeinschaftlich oder fördern komplementär.
Aber Staat und Kommunen sind sehr ungleiche Partner: kommunale Haushalte unterliegen anderen
Bedingungen und Zwängen als staatliche, weil sie immer ausgeglichen sein müssen. Außerdem
gilt Kunst und Kultur immer noch als freiwillige Aufgabe – kommt also erst zum Zug, wenn alle Pflichtaufgaben
gedeckt sind. Andere Bundesländer sind hier schon weiter.
Eine Herausforderung der Zukunft ist deshalb, Kommunen so auszustatten, dass sie Kunst und Kultur
als Teil der Daseinsvorsorge stemmen können. Kultur darf nicht länger freiwillige Leistung sein, sie
muss kommunale Pflichtaufgabe werden.
Wie kann Finanzierung zustande kommen? Förderung von Kunst und Kultur muss als Kernaufgabe
staatlichen Handelns verstanden werden. Deshalb brauchen wir auch einen Diskurs zu Aufgaben und
Zielen staatlicher Kulturförderung. Darauf aufbauend kann dann entschieden werden, wie viele
Mittel auf den jeweiligen Ebenen für Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt werden und woraus
diese Töpfe sich speisen.
Landeskultur-Entwicklungspläne, die Visionen und Ziele staatlichen Handelns definieren, und
Kulturfinanzberichte, die die Ausgaben für diese Ziele im Blick haben, gehören zu einem modernen
Verständnis solide legitimierter, gut finanzierter staatlicher Kulturpolitik.
Unser Anspruch:
- Landesentwicklungspläne Kultur: Diskurs mit Zivilgesellschaft, Verbänden, Kreativen,
Institutionen und Verwaltung zu Aufgaben und Zielen von Kulturförderung vorantreiben
und verbindliche Leitlinien schaffen
- Kulturfinanzberichte etablieren, wie sie in anderen Bundesländern schon existieren
- Kommunen bei Kunst- und Kulturförderung dauerhaft stützen
- Kultur als kommunale Pflichtaufgabe verankern
DIE KREATIVWIRTSCHAFT UND DIE KULTUR
Kunst und Kultur brauchen Raum für Experimente ohne Ziel; Raum für Scheitern und Wachsen. Die
Innovationskraft und Resilienz der Künste hat immense Bedeutung für unser Land. Vielfach öffnet
sich die Kulturszene für andere Bereiche und geht neue Partnerschaften ein, um innovativ zu
bleiben.
Diese Agilität wirkt auch in andere Sektoren unserer Gesellschaft.
Kunst und Kultur sind Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wie bei Sozialunternehmen ist auch bei
Kulturunternehmen der Mehrwert nicht immer ein materieller.
Kultur- und Kreativwirtschaft generiert ökonomischen Mehrwert, eine vor Ort starke
Bruttowertschöpfung. Und sie generiert sozialen Mehrwert.
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist Standortfaktor und wichtig für das Image einer Region –
niemand will dort leben, wo Bibliothek oder Kino eine Autostunde entfernt sind. Kultur- und
Kreativwirtschaft schafft Bildungsangebote im Sinne von lebenslangem Lernen und Krisenresilienz.
Diese enorme Kraft, die Dynamik und das große Potential der Kultur- und Kreativwirtschaft spiegeln
sich bisher nicht in adäquater und passgenauer Förderung wider. Eine koordinierte, gezielte und
strategische staatliche Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft als Teil von Standortpolitik ist
daher für Bayern überfällig:
Wir wollen einen besseren Zugang zu Wirtschaftsförderung und Förderprogrammen, die auf die
Branche zugeschnitten sind. Ein Beispiel sind Förderungen für nicht-technologische Innovationen:
Wieso gibt es bisher in Bayern zum Beispiel Geld für neue Kino-Lautsprecher, aber nicht für
innovative inhaltliche Angebote wie z.B. Kulturstreaming in den Kinosaal? Eine koordinierte,
institutionalisierte Kooperation von Wirtschaftsministerium und Kunstministerium istfür eine
gelungene Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft unabdingbar.
Die Kultur- und Kreativwirtschaft braucht wie jeder Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung.
Eigene künstlerische Forschung und Experiment fördern wir ebenso wie eine Zusammenarbeit der
Kultur- und Kreativwirtschaft mit Wissenschaft und Forschung, wie zum Beispiel im Bereich der
Künstlichen Intelligenz oder bei soziologischen Themen.
Grundlagen erfolgreichen Wirtschaftens sollten in Zielvereinbarungen der Ausbildung von Kreativen
fest verankert werden. Bis Kreative, die wirtschaftlich arbeiten möchten, am Markt etabliert sind,
vergehen oft viele Jahre, gleichzeitig sind Budgets in Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft
oft deutlich geringer als in klassischen Industrien. In Förderprogrammen sind daher
Gründungsphasen zu flexibilisieren und Bagatellegrenzen möglichst zu vermeiden.
Kultur- und Kreativwirtschaft profitiert von freien Künsten: Kreative Prozesse und freie künstlerische
Arbeit verbinden innovative Wirtschaft, sich wandelnde Gesellschaft, moderne Bildung im Sinne
einer BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) sowie agile Wissenschaft und Forschung. Kunst
und Kultur können Diskursräume öffnen und Fragen der Ethik, der Ziele wirtschaftlichen Schaffens
wie auch gesellschaftlichen Handelns und der Verantwortung verhandeln. Reallabore können dies
unterstützen. Auch freie Künste dienen so als Motor von Wirtschaft und als Teil der Kultur- und
Kreativwirtschaft.
Diese Dualität von freier Kunst und Wirtschaftskraft gilt auch für den Medien- und Filmbereich,
einen wesentlichen Teil unseres kulturellen wie wirtschaftlichen Lebens in Bayern. Und sie gilt für
Architektur und Werbung, wo Stadtbild und Zugehörigkeit verhandelt und Images für
gesellschaftliche Gruppen oder Lebensräume geschaffen werden.
Unser Anspruch:
- Kultur- und Kreativwirtschaft als resilienten Wachstums-Motor und Standort-Faktor
anerkennen und wie andere anerkannte Wirtschaftszweige fördern
- Vernetzung mit anderen Branchen und der Wissenschaft voranbringen
- Zugang zu Wirtschaftsförderung im nicht-technologischen Bereich für Kultur- und
Kreativwirtschaft etablieren
- wirtschaftliche Basics in Ausbildungs-Zielvereinbarungen berücksichtigen
DIGITALISIERUNG GEHÖRT DAZU
Nachhaltigkeit bedeutet auch Zukunftsfestigkeit. Digitalität ist dabei selbstverständlich Teil von
Kunst und Kultur.
Die Möglichkeiten der Monetarisierung digitaler Angebote hinkt der Nutzung digitaler Angebote
massiv hinterher. Die digitale Transformation begann lange vor der Pandemie und wurde durch
diese enorm beschleunigt.
Wie erleichternd wäre es für Kreative, von bleischweren Antrags- und Zuwendungs-Nachweis-
Papierbergen befreit zu werden. Das Publikum erfährt durch umfassende digitale Services nicht nur
ein verbessertes Kulturerlebnis, es kann auch gezielt nach veränderten Interessen oder einer
Besuchserfahrung befragt werden. Das hilft, die Angebote unserer staatlichen und staatlich
geförderten Einrichtungen weiter zu verbessern.
Bühnen, Museen, Bibliotheken, Archive, Kinos, Theater, Konzert- oder Opernhäuser: Wir stehen für
eine ganzheitliche Strategie in den Kultureinrichtungen aller Sparten, um den digitalen Wandel und
die daraus erwachsenen Bedarfe zu stemmen.
In Teams und beim Publikum brauchen in diesem Prozess Digital Natives und weniger digitalaffine
Menschen gleichermaßen Raum.
Unser Anspruch:
- Coaching- und Beratungsleistungen für digitale Angebote lancieren
- Monetarisierung digitaler Angebote voranbringen
- Ehrenamts- und Profi-Kultur aller Sparten den digitalen Wandel ermöglichen
- Anlaufstellen und Fördertöpfe für diese Transformation schaffen
- digitale Antrags- und Abrechnungsprozesse etablieren
- Digital Ticketing und digitale Evaluation der Besuchserfahrungen bei staatlichen Angeboten
EHRENAMT
Eine starke Demokratie lebt von den Menschen, die sie tragen. Ehrenamt und demokratisches
Engagement stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie verlässlich zu fördern, ist unsere
Aufgabe, auch im Bereich Kunst und Kultur.
Wir GRÜNE finden, bürgerschaftliches Engagement soll kein Ersatz für staatliche Förderung werden.
Aber wenn das Ehrenamt schon dort hilft, wo sich der Staat in der Vergangenheit zurückgezogen hat,
muss es zumindest unterstützt werden.
Das betrifft bei Bedarf zum Beispiel Unterstützung dabei, sich professioneller zu organisieren und zu
strukturieren.
Oft fehlen Ehrenamtlichen Ressourcen für Administration. Hier kann auch der Vorschlag der
Bundestags-Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ für den Ehrenamtsbereich helfen,
bürgerschaftliches Engagement als Eigenleistung anzuerkennen und die Verwendungsnachweise
von Mitteln zu vereinfachen.
Ein reges Engagement der Zivilgesellschaft im Ehrenamt fördert das Kunst- und Kulturverständnis
vor Ort. Alle Formen von Kooperationen zwischen Kultur und Gesellschaft sind deshalb zu fördern –
sei es inhaltlich, organisatorisch, räumlich oder finanziell.
Neben dem traditionellen Ehrenamt in gewachsenen Strukturen wächst in Bayern projektbasiertes
ehrenamtliches Engagement, aber auch die ehrenamtliche Beteiligung an Partizipationsformaten,
wie beispielsweise Open Stages. Diese neuen Formen der Beteiligung und Interaktion werden für die
gesamte Kulturszene immer wichtiger. Wir wollen darum Partnerschaften zwischen
Kultureinrichtungen, Initiativen, Vereinen, interessierten Laien, engagierten Gruppen, usw.
unterstützen und fördern.
Auch hier sollen verbesserte Qualifizierungsangebote, Abbau von Hürden in Förderstrukturen und
niedrigschwellige Beratungs- und Vernetzungsangebote Wissen bündeln und eine Grundlage für
flexiblere Förderung sein.
Unser Anspruch:
- Ehrenamt im kulturellen Bereich inhaltlich, organisatorisch und räumlich stützen
- neue Beteiligungs- und Partizipationsformate aufgreifen
- Partnerschaften zwischen ehrenamtlichen und professionellen Kulturschaffenden sowie
- Institutionen durch Qualifizierungsangebote, Abbau von Hürden in Förderstrukturen und
- Beratungsangebote verbessern
CORONA
Die Corona-Politik der CSU-FW-Regierung hat in Bayern zu einem massiven Vertrauensverlust der
Kultur in die Politik und zu einer nie dagewesenen Schrumpfung im für die Liquidität von
Kulturbetrieb nötigen Vorverkauf geführt. Gleichzeitig ist das Publikum ins Private und Digitale
abgewandert, ohne dass es tragfähige Konzepte für die Monetarisierung digitaler Kulturangebote
gäbe. Das Ende dieser Entwicklungen deutet sich aktuell nur zögerlich an.
Entsprechend ist jetzt eine gemeinsame Anstrengung gefragt, bestehende Strukturen zukunftsfähig
zu machen, neue Publika zu erschließen und alte zurückzugewinnen.
Veränderung ist immer auch eine Chance. Die Kulturpolitik muss dabei begleiten, unterstützen und
Ressourcen für die Transformation dort, wo sie fehlen, bereitstellen. Die kulturelle Vielfalt in Land
und Stadt sicherzustellen, bleibt dabei eine wichtige Aufgabe.
Unser Anspruch:
- die Kulturbranche nach Krisen beim Wiederaufbau unterstützen
- die einmalige Chance zur strukturellen Transformation der Kulturbranche nutzen und
abseits von Nachwuchssorgen und Mitteldebatten zukunftsfest machen
KUNSTFREIHEIT
Die Kunst ist frei. Sie unterliegt keinem Zweck und steht für sich selbst. Sie bildet und stärkt und
wirkt mit ihren Diskursräumen und Angeboten gegen die Kräfte, die an unserer Demokratie zerren.
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“
Art. 5 Absatz 3 Grundgesetz
Der Nationalsozialismus markiert auch für Bayern den stärksten Bruch unserer Zivilisation und Kulturgeschichte.
Durch Mord und Vertreibung wurden verschiedene künstlerische und ästhetische Traditionslinien eliminiert,
die unsere bayerische Kunst und Kultur mitgeprägt haben. Aus diesen Erfahrungen erwächst eine
besondere Verantwortung für den elementaren Wert der Freiheit der Kunst in Werk und Wirken.
Aktuelle kulturpolitische Debatten, aber auch das reflexhafte Schließen unserer Kulturorte mit den Wellen
der Pandemie zeigen, dass die im Grundgesetz festgeschriebene Kunstfreiheit keine Selbstverständlichkeit ist.
Wir wollen ein politisches und gesellschaftliches Umfeld für Kunst und Kultur bewahren, das Kunst
nicht in den Dienst nimmt für Interessen von Ausgrenzung, Hass oder Nationalismus. Es ist unsere
Aufgabe, Kunst und Kultur als Möglichkeits-Räume zur freien und zukunftsfähigen Entwicklung zu
schaffen.
Unser Anspruch:
- freie Erprobungs- und Möglichkeitsräume schaffen
- Kunst und Kultur ohne Zweck, als Wert an sich fördern
- Kunstfreiheit sichern
HISTORISCHE VERANTWORTUNG
„Die Erinnerungskultur einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft zeigt sich offen für die vielstimmigen
Geschichten und Erzählungen sowie die unterschiedlichen historischen Erfahrungen der Menschen, die hier leben.
Auch die kritische Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit und der damit verbundenen Verbrechen muss
selbstverständlicher Teil unserer (…) Erinnerungskultur sein. Das ist Voraussetzung für eine Gesellschaft, in
der alle Menschen frei von Rassismus leben können. Deutschlands Kolonialvergangenheit ist auch im
Kulturbereich viel zu wenig aufgearbeitet. “
Grundsatzprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zeitgenössische Kunst ermöglichen und kulturelles Erbe bewahren – beides muss gleichzeitig gelingen, auch
wenn die Ressourcen knapp sind. Archive, Bibliotheken, Museen, aber auch Neuinterpretationen
historischer Stoffe leisten hier einen wichtigen Beitrag.
Die Aufarbeitung unserer kolonialen Geschichte und Verantwortung bleibt in engem Schulterschluss
von Museen, Hochschule, Forschung und Initiativen in Bayern und in den ehemals kolonisierten
Ländern wichtige Aufgabe.
Kooperation auf Augenhöhe und gegenseitiger Respekt dabei kann wiederum neue, produktive
Kooperationen möglich machen – international, aber auch vor Ort.
Prägend für Deutschland bleibt auch der Zivilisationsbruch der Shoa. Ein starkes Land wie Bayern
sollte denen, die es lieben, keine weiteren Überraschungen im Bereich der NS-Raubkunst kredenzen.
Oberste Priorität hat deshalb ein Ampelsystem für als unbelastet geklärte Kunst, Kunst mit unklarer
Provenienz und Raubkunst. Es braucht den politischen Willen, damit Datenbanken und Archive
endlich zugänglich gemacht werden.
Bei strittigen Fällen ist die Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-
verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts (“Limbach-Kommission”), die der Freistaat mit ins Leben
gerufen hat, anzurufen. Private Stellen sind aufgefordert, dies dem Freistaat nachzutun.
Für belastete Objekte muss rasch und unbürokratisch eine individuelle Lösung (Rückführung oder
Entschädigung) mit den Hinterbliebenen der rechtmäßigen Eigentümer*innen gefunden werden.
Digitale Datenbanken müssen künftig für alle zur Verfügung stehen. Nur dann können auch die Erben
von Eigentümer*innen aktiv werden und die Provenienzforschung selbst voranbringen. Mehr
als sechzig Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer und in Erwartung des 50. Jahrestages ihres Falls
tritt auch die Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte in den Blick der Aufarbeitung: Pilotprojekte
wie das zur Untersuchung kritischer Provenienzen aus SBZ und DDR in nichtstaatlichen Museen des
Freistaats Bayern sind daher begrüßenswert.
Unser Anspruch:
- Provenienz-Ampelsystem für Kunstwerke
- Objekte noch stärker digitalisieren, Archive und Datenbanken zugänglich machen
- Lösungen für die Hinterbliebenen der rechtmäßigen Eigentümer*innen von belasteten Objekten finden
- Kooperation mit der Beratenden Kommission
GESCHLECHTERGERECHT UND FAMILIENFREUNDLICH!
Gleichberechtigung bedeutet Sichtbarkeit, Repräsentanz und Chancen. Strukturelle Benachteiligung
von Frauen beginnt oft mit der Elternzeit und setzt sich bei der Altersdiskriminierung junger oder
älterer Frauen fort.
Gerade im Kunst- und Kulturbereich, wo Förderungen oft ans Lebensalter gekoppelt sund, genauso
wie bei Stipendien und Residencies, wenig an die Realitäten von Menschen mit Familie angepasst
sind, braucht es Korrekturen, um strukturellen Wandel zu ermöglichen.
Kinderbetreuungsmodelle sind deshalb förderfähig zu machen, um Frauen, die immer noch einen
großen Teil der Care-Arbeit leisten, Zugang zum Arbeitsmarkt Kultur zu erleichtern.
Kinder und die Zeit, die man mit ihnen verbringt, dürfen für Stipendien und Förderungen kein
Hindernis mehr sein.
Wo Förderung und freiwillige Selbstverpflichtung nicht greifen, sind Quoten ein wichtiges
Instrument, in der Hoffnung, dass sie sich eines Tages selbst überflüssig machen.
Unser Anspruch:
- Kriterien staatlicher Förderungen, Stipendien und Residency-Programme an die Realitäten
von Menschen mit Familie anpassen
- Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit bei Kulturproduktion förderfähig machen
- wenn nötig, Quoten als Instrument für Parität einsetzen
DIVERS!
Kulturelle Teilhabe muss für alle möglich sein. Und alle bedeutet ALLE –
- im kreativen Prozess, sei es in Laienkultur oder im Profibereich,
- in der künstlerischen Ausbildung und kulturellen Bildung,
- durch Sichtbarkeit in Inhalten und
- als Zielgruppe und Publikum
Umfassende Teilhabe mit all ihrer Diversität bereichert künstlerische Prozesse um neue
Perspektiven, Orte, Ideen und Möglichkeiten. Teilhabe ist ein Prozess. Wo sie noch nicht umgesetzt
ist, sind wir gefordert, sei es an sichtbaren Stellen oder auch in internen Strukturen.
Geschlechtergerechtigkeit und Diversität braucht es in allen Bereichen unserer Institutionen, in
Teams, aber auch in allen Führungsebenen und in der Besetzung von Gremien und Jurys. Wo
Gremien und Jurys klein sind, kann es helfen, durch Leitfäden, Schulungen oder Hinzuziehung der
Expertise Betroffener unterschiedliche Perspektiven abzubilden oder neue Zielgruppen zu
erschließen.
Öffentliche Mittel sind für alle Teile der Gesellschaft da. Deshalb darf eine Vergabe von
Fördermitteln geknüpft sein an konkrete Konzepte zur Weiterentwicklung von Institutionen und
Organisationseinheiten im Sinne von Diversität und Geschlechtergerechtigkeit.
Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass die Einbeziehung jüngerer Perspektiven und
Erfahrungen von Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien oft schon zu einer
Diversifizierung in vielen anderen Bereichen führt.
Diversitäts-Beauftragte können bei einer Öffnung hin zu mehr Teilhabegerechtigkeit helfen.
Ebenso hilfreich wäre die staatliche Förderung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammen
für Kunst- und Kultureinrichtungen und Kommunen zur teilhabeorientierten Öffnung und
diversitätsbewussten Entwicklung.
Unser Anspruch:
- Teilhabe im kreativen Prozess, in der künstlerischen (Aus-)Bildung, der inhaltlichen
- Repräsentation und der Rezeption ermöglichen
- Maßnahmen für die Sensibilisierung von Entscheidungsträger*innen auf den Weg bringen
- Konzepte für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit bei Mittelvergabe
- entsprechende Förderungen von Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammen für Kunst-
und Kultureinrichtungen sowie Kommunen
- Kommunikation staatlicher Kultureinrichtungen an Weltstandards anpassen und auf solide
und zeitgemäße Füße stellen
KULTURELLE BILDUNG
Ästhetische Bildung ist eine Bildung, die das Verständnis für Kunst und Kultur und die kritische
Auseinandersetzung damit fördert. Sie hilft, kreatives Denken, Sensibilität und Analysefähigkeit zu
entwickeln. Sie sorgt gleichsam für die Entwicklung von Publika als auch für das Wachsen
künstlerischen Nachwuchses. Ästhetische Bildung wirkt ganzheitlich, gewährleistet nachhaltiges
Lernen und inneres Wachstum. Sie macht stark und klug.
Alle Gruppen der Gesellschaft sollen deshalb Zugang zu ästhetischer Bildung haben, aber auch auf
individuelle Weise von kulturellen und künstlerischen Angeboten angesprochen werden. Deshalb
gilt es, Angebote in Kulturinstitutionen, aber auch in Einrichtungen der Zivilgesellschaft – in
Gruppen, Vereinen und Initiativen – zu stärken und Zugänge zu ermöglichen.
Kulturpolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik. Wir haben in Bayern mehrfach erlebt, wie
Ausgrenzung und Diskriminierung, Hass und Hetze in Gewalt umschlagen können. Kulturelle Bildung
stärkt Demokratie und schützt vor Diskriminierung, gruppenbezogenem Menschenhass und
Populismus. Kunst und Kultur können zwischen Kulturen vermitteln und helfen, andere zu
verstehen.
In einer Welt, die immer schneller wird, mit einem Überfluss an Angeboten ist es für Kinder
und Heranwachsende nicht leicht, eine Orientierung zu finden. Kunst und Kultur können eine solche geben.
Bei der kulturellen Bildung geht es um den ganzen Menschen, um die Bildung seiner
Persönlichkeit, um Emotionen und Kreativität. Ohne kulturelle Bildung fehlt ein Schlüssel zu wahrer Teilhabe.
Deshalb ist auf keinem Feld die Verantwortung des Staates, aber auch der Zivilgesellschaft und der
Kultureinrichtungen größer. Kulturelle Bildung macht nicht nur stark, sondern auch klug. Denn sie hat gleichermaßen
Auswirkungen auf Persönlichkeitsentwicklung und Lernfähigkeit. Ein besonderes Augenmerk auf die Belange
kultureller Bildung zu legen war deshalb für viele von uns Herzensangelegenheit. Dabei darf der Blick nicht
nur auf Kinder und Jugendliche gelegt werden.
Grundsatzprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
In Institutionen wie Landesjugendkunstschulen oder Musikschulen wird bereits viel geleistet. Die
kulturelle Bildung muss aber in allen Bereichen öffentlichen Lebens als Handlungsfeld begriffen
werden, das in die Gesellschaft hineinwirken kann.
Stichwort ist hier “Outreach und Community”: Outreach als die Kommunikation nach außen – also
gezielt auf Menschen zuzugehen, um sie zu erreichen und sie teilhaben zu lassen. Community als die
Gemeinschaft – also Menschen zusammenzubringen, die bereits miteinander verbunden sind über
eine in irgendeiner Weise gemeinschaftliche Identität, lokal, regional oder auch virtuell. Dafür braucht es
eine solide Grundfinanzierung von Institutionen, die Outreach und Community, kulturelle
Bildung und Vermittlung miteinschließt.
Wir werden unserem Anspruch nicht gerecht, solange kulturelle Bildung hauptsächlich aus
Drittmitteln finanziert wird, also überhaupt nicht im Fokus der Kulturpolitik liegt.
Es gibt keine Ansprechpersonen auf höchster Ebene für kulturelle Bildung, denn sowohl das
Bildungs- als auch das Kunstministerium sind irgendwie verantwortlich, aber niemand richtig. Die
Staatskanzlei macht kulturelle Bildung, wenn es um Medien geht, das Finanzministerium mischt mit,
sobald “Heimat” drauf steht, das Sozialministerium macht kulturelle Bildung für sozial schlechter
Gestellte, usw. Die Koordination der Bemühungen unterschiedlichster Verwaltungen auf lokaler,
regionaler und staatlicher Ebene funktioniert ohne zentrale Ansprechpartner und ohne Vernetzung
der Zuständigkeiten unterschiedlicher Ministerien nicht.
Kulturelle Bildung braucht einen zentralen Ort, der institutionsübergreifend Ansprechpersonen und
Vernetzung bietet: ein eigenes Kompetenzzentrum kulturelle Bildung für Schulen, private und
kommunale Bildungseinrichtungen und Kulturlandschaft.
Diese zentrale Anlaufstelle zu schaffen ist drängend und wichtig, um Schulen, Kitas,
Volkshochschulen, Sing- und Musikschulen, Jugendkunstschulen sowie alle weiteren
außerschulischen Verbände und Organisationen sowie Kulturinstitutionen stärker in staatliches
Handeln einzubeziehen und vielfach parallel agierendes staatliches Handeln zentral zu vernetzen.
Dieses Kompetenzzentrum kann Transformation begleiten – zum Beispiel 2026 die Umstellung auf
Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Es kann die zentrale Einrichtung im Freistaat werden für
Beratungs- und Qualifizierungsleistungen sowie für die Vernetzung im gesamten Themenspektrum
der kulturellen Teilhabe und Bildung.
Wir müssen in Bayern im Bereich kulturelle Bildung inhaltlich wie finanziell an die Standards
anderer Bundesländer aufschließen.
Überall dort, wo der Staat tätig wird, sind die Entwicklungen wissenschaftlich zu begleiten und
stetig zu evaluieren, um bei Bedarf angepasst werden zu können.
Unser Anspruch:
- kulturelle Bildung als festen Baustein der Kulturförderung verstetigen
- Stellen für kulturelle Bildung an allen staatlichen Kulturinstitutionen schaffen und ausbauen
- Expertise und Wissen bündeln: zentrale Anlaufstelle für Initiativen der kulturellen Bildung schaffen
FAIR GREEN CULTURAL DEAL
„Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav lebenUnd Sünd und Missetat vermeiden kann
Zuerst müßt ihr uns was zu fressen geben
Dann könnt ihr reden: damit fängt es an.“
Bertold Brecht.,„Wovon lebt der Mensch?“ Zweites Dreigroschen-Finale
Die bayerische Staatsregierung hat im Juli 2021 Klimaneutralität bis 2040 als Ziel für Bayern gesetzt.
Dieser Anspruch muss von Handeln begleitet werden und wirkt in alle Bereiche unseres Lebens. Wir
Grüne sehen Nachhaltigkeit dabei ganzheitlich und betrachten sowohl die soziale als auch die
ökologische Nachhaltigkeit. Um alle Menschen mitzunehmen, ist ein gemeinsames, paralleles
Entwickeln von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit unabdingbar. Das betrifft auch den Kulturbereich.
Staatliche Einrichtungen brauchen personell und finanziell die richtige Unterstützung für die Erarbeitung
eines in Zukunft verbindlichen Nachhaltigkeitskonzepts für Klima, Umwelt und soziale Strukturen. Wir
brauchen den Fair Green Cultural Deal.
Um die Transformation im Kulturbereich zu fördern, möchten wir spezielle Beratungsangebote
ebenso etablieren wie die Qualifizierung von Fachkräften auf dem Gebiet des
Transformationsmanagements.
Kunst braucht Austausch. Wo Mobilität nötig ist, versuchen wir die Umweltkosten-Nutzen-Rechnung
in Richtung einer positiven Nutzung des CO2-Budgets zu verschieben. Dafür braucht es inhaltliche
und zeitliche Verbesserungen: Es hilft, mit der Bahn zu fahren, es hilft aber auch, nicht nur für einen
einzigen Termin zu reisen oder Objekttransporte zu bündeln. Für Gastverträge ermöglichen wir
umweltfreundliches Reisen durch Anerkennung der Reisetage als Arbeitszeit, sofern nicht geflogen
wird.
Materialinitiativen, die in Kunst und Kultur benötigte Materialien sammeln, aufbereiten und der
Mehrfachnutzung zuführen, etablieren wir bayernweit als Standard.
Nachhaltigkeit ist mehr als CO2 und Müll: Sozial-ökologische Nachhaltigkeit ebenso wie
Klimafreundlichkeit sind Aspekte, die bei staatlicher Kulturförderung in Bayern förderfähig werden
müssen. Anreize sind wichtig, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen.
Die Kultur ist ein Bereich, dem in der Vergangenheit vielfach neue Aufgaben aufgebürdet wurden
und dem trotz struktureller Unterfinanzierung nie automatisierte Anpassungen an Inflation oder
Kostendruck zuteil wurden. Deshalb braucht die Kultur Unterstützung, um diese wichtigen Aufgaben
stemmen zu können.
Unser Anspruch:
- Nachhaltigkeit in allen Dimensionen fest in der Struktur von Kulturinstitutionen verankern
– Transformationsmanagement als Weiterbildung anbieten und Stellen in diesem
– Bereich finanzieren
– Nutzung von Material-Initiativen zum Standard machen
– Nachhaltigkeits-Konzepte etablieren, finanzieren und umsetzen
– Handlungsfelder für Transformationsprozesse für jede Institution festlegen
– Green Culture Desk auf Landesebene als zentrale Koordinationsstelle etablieren
- staatliche und nichtstaatliche Institutionen bei der Transformation unterstützen
- Maßnahmen für Nachhaltigkeit bei staatlichen Förderungen förderfähig machen
- Beratung zur Nachhaltigkeit förderfähig machen
- in allen Bezirken Ansprechpersonen für Nachhaltigkeits-Beratung für solo-Selbständige
- Kreative einrichten
- Mittel für Nachhaltigkeitsmaßnahmen bereitstellen