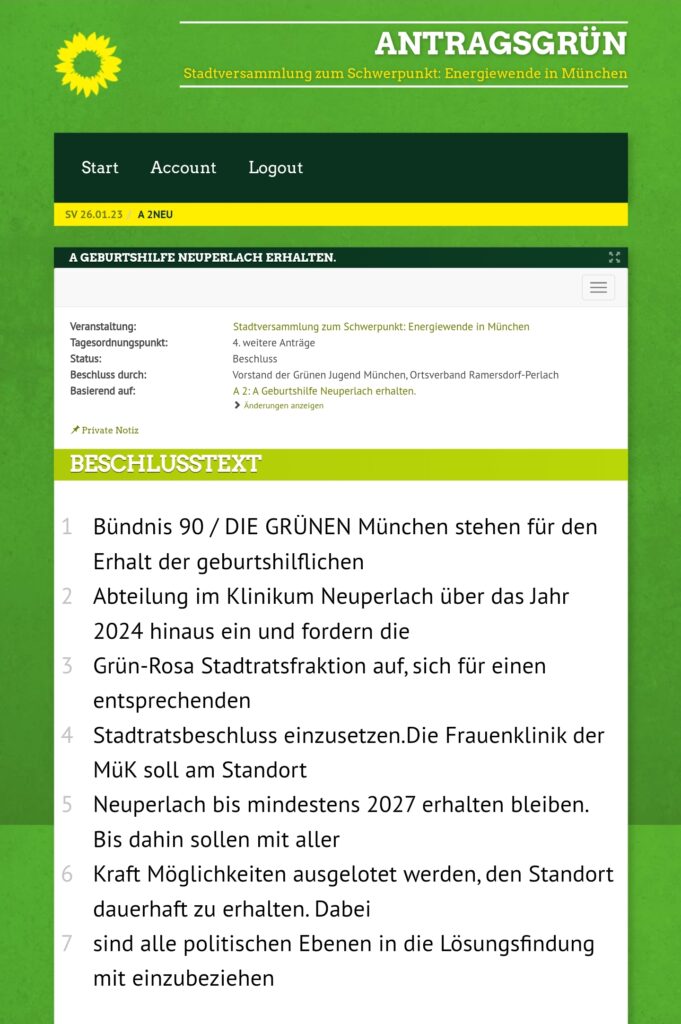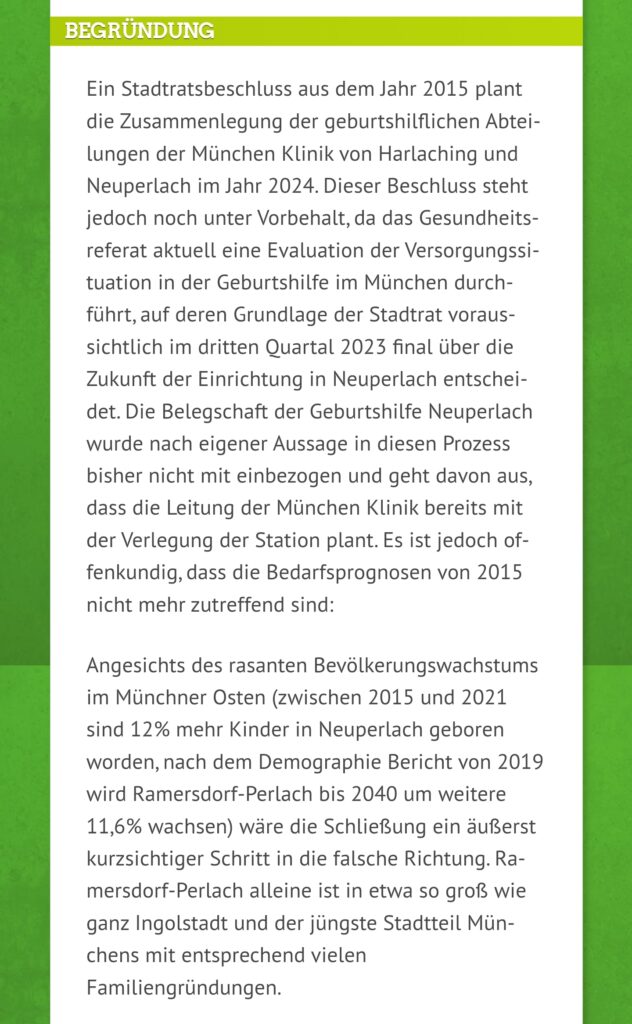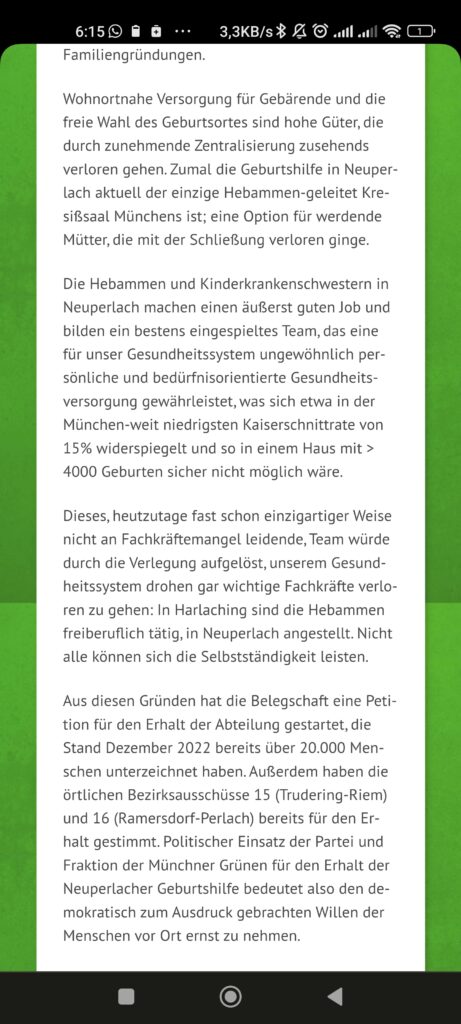Frage 1:
1.1 Welche konkreten Berechnungen haben Ministerpräsident Söder veranlasst, beim Konzerthaus im Werksviertel von Baukosten von über 1 Milliarde € zu sprechen, nachdem im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen am 8. Juli 2021 noch von 580 Millionen € die Rede war und die Differenz selbst mit den seither gestiegenen Baukosten nicht zu erklären ist?
Antwort zu Frage 1.1:
Am 8. Juli 2021 wurde im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags der Vorentwurf für das Bauprojekt vorgestellt. Die Kostenschätzung wies zu diesem Zeitpunkt Gesamtkosten in Höhe von rd. 580 Mio. € aus. Hinzu kommen nach den Regularien der aktuell geltenden RLBau 2020 Kostenansätze für Baupreissteigerungen bis zur Baufertigstellung und Kostenansätze für Risikovorsorge. Im Vergleich zu 2021 sind nunmehr insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die daraus folgenden Preissprünge im Energie- und Industriesektor, exorbitanten Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie die unkalkulierbare Inflationsentwicklung zu berücksichtigen. Die Kostenentwicklung ist nach allen Erkenntnissen realistisch und na- heliegend.
1.2 Wurden die Stiftung Neues Konzerthaus München, der Grundstückseigentümer und die weiteren Partner und Akteure wie der BR und das BR-Symphonieorchester etc. im Vorfeld über die Entwicklung informiert?
Antwort zu Frage 1.2:
Sowohl der Öffentlichkeit als auch den Partnern wie Konzerthaus-Stiftung, dem Grundstücks-Eigentümer, dem BR bzw. dem BRSO wurden die Schätzkosten vorgetragen. Die dynamische Entwicklung der Baupreise ist zudem allgemein nachvollziehbar.
1.3 Seit wann ist der hohe Sanierungsbedarf bei Kulturbauten, der als ein maßgebender Grund der „Denkpause“ genannt wurde, der Staatsregierung bekannt?
Antwort zu Frage 1.3:
Sanierungen sind eine Daueraufgabe. In Folge der seit 2021 massiv gestiegenen Baukosten ist allerdings die finanzielle Größenordnung des Gesamt-Sanierungsbedarfs bei Kulturbauten noch einmal erheblich gestiegen.
Frage 2:
2.1 Was im Einzelnen wird während der ausgerufenen „Denkpause“ unternommen (bitte mit Angabe der beteiligten Akteure und den konkreten Maßnahmen und Überlegungen)?
2.2 Welche „Optionen“, „die bislang noch nicht im Blick waren“, sollen während der „Denkpause“ erörtert werden (Antwort auf eine Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Dr. Heubisch vom 30.03.22, Drs. 18/22114)?
2.3 Wie werden die Partner und Akteure (Frage 2) über die Aktivitäten und Diskussionen in dieser Zeit informiert und eingebunden?
Antwort zu Fragen 2.1 bis 2.3:
Für das Projekt Konzerthaus werden im Kontext der anstehenden Sanierungen bei Kulturbauten in München verschiedene Optionen untersucht, wie sich öffentliche Investitionen auch vor dem Hintergrund der bestehenden und zu erwartenden Belastungen für die öffentlichen Haushalte aufgrund der aktuellen Krisen verantwortungsvoll gestalten lassen. Da es sich um einen laufenden Prozess handelt, kann zu den Details und den eingebundenen Akteuren aktuell noch keine Auskunft gegeben werden.
Frage 3:
3.1 Sind in den laut der Anfrage bisherigen Planungskosten für das Konzerthaus von 16,4 Millionen € (nach noch knapp 7 Millionen € im Jahr 2020) auch die Personalkosten der mit der Planung befassten Beschäftigten der staatlichen Behörden wie z.B. des Staatlichen Bauamts München enthalten?
3.2 Wenn nein, wie hoch werden sie beziffert?
Antwort zu den Fragen 3.1 und 3.2:
In den genannten Planungskosten sind Personalkosten staatlicher Behörden nicht berücksichtigt. Am Staatlichen Bauamt München 1 sind seit 2016 im Zusammenhang mit der Planung Personalkosten in Höhe von rd. 5 Mio. € angefallen. Das StMB begleitet das Projekt auf ministerieller Ebene, ein Kostenanteil für die Beteiligung am Planungsprozess lässt sich nicht beziffern.
Im StMWK sind von 2016 an mehrere Beamte (Referatsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) mit dem Projekt befasst. Diese sind zeitgleich noch mit weiteren Aufgaben betraut. Ein Kostenanteil lässt sich nicht sinnvoll beziffern. Die Personalkosten für eigens und ausschließlich für das Projekt angestellte Personen (Technischer Planungsdirektor, Öffentlichkeitsarbeit) belaufen sich seit 2016 auf rund 643.000 €.
3.3 Werden die Planungen für den Bau auch während der „Denkpause“ fortgesetzt?
Antwort zu Frage 3.3:
Es gibt derzeit keinen Planungsstopp.
Frage 4:
4.1 Wird die Entscheidung über den Bau spätestens bis kurz nach der Sommerpause 2022 – wie Minister Blume bei der Diskussionsveranstaltung der Süddeutschen Zeitung ankündigte – feststehen?
4.2 Welche Bedingungen und Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass die Staatsregierung doch weiter am Bau festhält?
Antwort zu Fragen 4.1 bis 4.2:
Eine Entscheidung wird getroffen werden, wenn die Ergebnisse der aktuellen Denk- und Diskussionsphase ausgewertet sind und Klarheit über wesentliche Rahmenbedingungen herrscht.
Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
4.3 Welche Einsparmöglichkeiten werden geprüft, um den Bau im Rahmen der Kosten, der letztes Jahr im Haushaltsausschuss genannt wurde, zu realisieren?
Antwort zu Frage 4.3:
Zum laufenden Planungsprozess gehört auch eine regelmäßige Prüfung von Einsparpotenzialen. Dies betrifft zum Beispiel den Bereich der Bühnen- und Medientechnik.
Frage 5:
5.1 Wie viele externe Dienstleister*innen sind derzeit mit Planungsaufgaben betraut?
Antwort zu Frage 5.1:
Am Konzerthausprojekt arbeiten derzeit rund 30 Planungsbüros.
5.2 Wie hoch sind die Kosten für den Freistaat aus bestehenden Vertragspflichten mit Dienstleister*innen, sollten die Planungen eingestellt werden?
Antwort zu Frage 5.2:
Bei einem sofortigen Planungsstopp wäre über die bereits angefallenen Zahlungen hinaus mit Kosten in einer Größenordnung von rd. 7 Mio. € aus den bestehenden Vertragspflichten zu rechnen.
5.3 Sieht der Erbpachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer ein Kündigungsrecht vor, wenn der Freistaat vom Bau Abstand nehmen sollte?
Frage 6:
6.1 Wenn nein, wann ist der früheste Zeitpunkt, zu dem der Vertrag seitens des Freistaats gekündigt werden kann (bitte mit Angabe der bis dahin aufgelaufenen Pacht)?
Antwort zu Fragen 5.3 und 6.1:
Die Fragen 5.3 und 6.1 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:
Nein. Eine Kündigungsmöglichkeit nach Eintragung des Erbbaurechts widerspricht der gesetzlich vorgegebenen Systematik des Erbbaurechtsvertrages und ist deshalb nicht vorgesehen. Dementsprechend gibt es auch keinen Zeitpunkt für eine Kündigung.
6.2 Welche Pläne hat die Staatsregierung mit dem Baugrund, sollte das Konzerthaus nicht gebaut werden?
Antwort zu Frage 6.2:
Diese Frage würde sich nur stellen, wenn im laufenden Entscheidungsprozess eine Abkehr vom Projekt Konzerthaus beschlossen würde. Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
6.3 Welche Ziele wie z.B. paritätische Belegungsrechte in Gasteig und HP8 etc. will die Staatsregierung in den laut Süddeutscher Zeitung anstehenden Gesprächen mit der Stadt durchsetzen?
Antwort zu Frage 6.3:
Es steht dem Freistaat nicht zu, für städtische Kulturimmobilien Belegungsrechte „durchzusetzen“. Sowohl auf Seiten des Freistaats als auch seitens der Landeshauptstadt München sind derzeit im jeweiligen Verantwortungsbereich Rahmenbedingungen für die künftige Gestaltung des Kulturraums München zu klären, die in den vertrauensvollen und regelmäßigen Dialog zwischen Freistaat und Landeshauptstadt München einfließen.
Frage 7:
7.1 Wird ausgeschlossen, dass der Freistaat sich an den Kosten für die Sanierung des Gasteigs beteiligt?
7.2 Welche finanziellen Gegenleistungen für die Nutzung der städtischen Konzertsäle im Gasteig und im HP8 bietet der Freistaat der Stadt München?
Antwort zu Frage 7.1 und 7.2:
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 6.3 verwiesen.
7.3 Hat die Staatsregierung Kenntnisse von Konzertsaalbauvorhaben privater Investoren in München (bitte mit Angabe, ob sie den staatlichen Orchestern und/oder dem BRSO Belegungsrechte einräumen werden)?
Antwort zu Frage 7.3:
Zu möglichen Vorhaben privater Investoren kann der Freistaat keine Auskunft geben.
Frage 8:
8.1 Welche Priorität räumt die Staatsregierung der Sanierung und Ertüchtigung des Herkulessaals ein?
8.2 Gibt es dafür einen Zeitplan und Kostenschätzungen?
Antwort zu Frage 8.1 und 8.2:
Im Herkulessaal der Residenz München werden laufend bauliche Maßnahmen zur Verbesserung und Ertüchtigung durchgeführt. Durch eine Reihe von Baumaßnahmen konnte der Herkulessaal bereits ertüchtigt werden. Aktuell erfolgt die Instandsetzung der defekten Bühnentechnik. Mittel- bis langfristig steht eine Instandsetzung der Haustechnik des Festsaalbaus mit Herkulessaal der Residenz München an.
8.3 Wird im Fall, dass das Konzerthaus nicht gebaut wird, Ersatz geschaffen für jene Bereiche des Konzertbaus, die für Education, die Musikhochschule, Zukunftsformate, die Freie Szene usw. vorgesehen waren?
Antwort zu Frage 8.3:
Diese Frage würde sich nur stellen, wenn im laufenden Entscheidungsprozess eine Abkehr vom Projekt Konzerthaus beschlossen würde. Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.