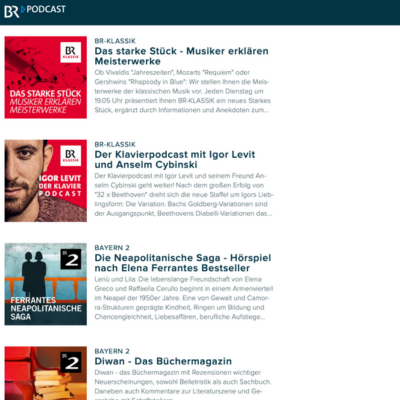Antrag „Eiertanz um die Intendanz der Bayerischen Staatsoper beenden: Erfolge absichern, klare Perspektiven für Personal und Publikum schaffen, Landeshauptstadt als Kulturstandort nicht gefährden“
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, unverzüglich Klarheit zur vertraglichen Situation des Führungspersonals an der Bayerischen Staatsoper zu schaffen. Werden die bestehenden Verträge mit dem aktuellen Intendanten, dem aktuellen Generalmusikdirektor und dem aktuellen Ballettchef nicht oder nur für weniger als fünf Jahre verlängert, muss zeitnah eine Findungskommission für eine neue Intendanz eingesetzt werden. Um maximale Staatsferne zu gewährleisten und beste Köpfe zu bekommen, soll das zuständige Staatsministerium ausgewiesene Expertinnen und Experten benennen, die Vorschläge für Persönlichkeiten einer Findungskommission machen sollen.
Begründung:
Mit dem Hin und Her um das Spitzenpersonal an der Bayerischen Staatsoper schadet die Staatsregierung dem Ansehen des Hauses. Für eine valide Planung, gute Kommunikationsarbeit, künstlerische Exzellenz und damit ausgelastete Vorstellungen ist es dringend geboten, Planungssicherheit für den Opernbetrieb zu gewährleisten. Mit dem Eiertanz um die künftige Leitung des Opernbetriebs, vor allem vor dem Hintergrund der in den 2030er Jahren anstehenden umfassenden Sanierungen, die auch auf die Programmatik des Hauses massive Auswirkungen haben werden, gefährdet die Staatsregierung eines der kulturellen Flaggschiffe des Kulturstaats Bayern. Für einen Opernbetrieb auf Spitzenniveau, den das Publikum und das Personal der Bayerischen Staatsoper zu Recht gewohnt sind, müssen Programme bis zu fünf Jahre im Voraus geplant werden. Renommierte Künstlerinnen und Künstler stehen sonst nicht mehr zur Verfügung. Die zögerliche Haltung der Staatsregierung gefährdet neben der Exzellenz des Programms auch die derzeit sehr gute Auslastung der Bayerischen Staatsoper, die mit 96 Prozent auf überdurchschnittlich hohem Niveau liegt. Für die Besetzung der Intendanz einer Oper mit Weltklasse, wie es die Bayerische Staatsoper zweifelsohne ist, spielt die fachliche Qualifikation, die einschlägige und langjährige Erfahrung bei der Leitung großer Häuser, die Vision und Innovationsfähigkeit zur Entwicklung des Programms eine entscheidende Rolle. Auch gute Netzwerke und Beziehungen, sowie Kommunikations- und Führungsfähigkeit sind Merkmale, die eine Intendanz selbstverständlich mitbringen muss. Damit die Bayerische Staatsoper auch künftig ein Haus von Weltrang bleibt, muss die Vermittlungsarbeit und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion in der Kunst Kriterium sein. Nur so kann nachhaltig Akzeptanz und Begeisterung für Spitzen-Kulturinstitutionen in allen Schichten der Bevölkerung erzielt werden. Nachdem ESG-Governance (ESG = Environmental, Social and Governance) heute selbstverständlich ist, muss eine gute Führungspersönlichkeit sich auch mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit des Hauses von Klimaschutz über Arbeitsbedingungen des Personals bis hin zu Barrierefreiheit auskennen und hier Maßnahmen implementieren können. All diese Kriterien müssen für künftige Findungskommissionen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden, um den Kulturbetrieb aus Spitzenniveau im Kulturstaat Bayern für die Zukunft zu sichern.